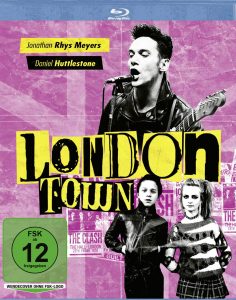
In einem Londoner Vorort der späten 70er Jahre hat der 14-jährige Shay (Daniel Huttlestone) es nicht leicht: Er muss neben seinen schulischen Verpflichtungen auch den Haushalt regeln und sich um seine jüngere Schwester Alice (Anya McKenna-Bruce) kümmern. Denn seine Mutter hat die Familie für eine Londoner Hippiekommune sitzen lassen und sein Vater Nick (Dougray Scott) muss sich in zwei Jobs Tag und Nacht um eine Lebensgrundlage für die Familie bemühen. Als Shay durch die ihm noch unbekannte Teenagerin Vivian (Nell Williams) an die Punkband The Clash herangeführt wird, ist es um ihn geschehen: Die Musik spricht zu ihm und gibt ihm die nötige Kraft, seinen harten Alltag zu bewältigen. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es noch Joe Strummer (Jonathan Rhys Meyers), den Frontmann von The Clash, der dem Jungen bei zufälligen Begegnungen die richtige Menge an „punkiger“ Weisheit mit auf den Weg geben kann …
Punkgott-Ex-Machina
Dieser kleine Independentfilm verspricht ein charmantes, musikinspiriertes Märchen mit einem interessanten politischen Setting. Ein schönes, zeitgemäßes Szenenbild gewährt dem Zuschauer den Zutritt zu einer Welt voller politisch motivierter Tumulte und aggressionsgesteuerter Musik. „Eine Coming-of-Age-Story mit kleinem Budget, aber großer Leidenschaft und echtem Herzblut“ – würde man gerne über den Film sagen. Allerdings stimmen hier zu viele grobe Grundlagen des Filmemachens einfach nicht mit der Prämisse überein. Außerdem erfüllt das märchenhaft klingende Element des Joe Strummer, der dem Protagonisten im Verlauf mit Rat und sogar Tat zur Seite steht, leider nicht den erhofften Zweck einer rahmengebenden Inspiration für diese angebliche „Punkgeschichte“, wodurch der Clash-Frontmann zu einem wirren Deus-Ex-Machina mutiert.
Auch die aufkeimenden Proteste und verfeindeten Lager knapp vor der Amtszeit der eisernen Lady Margaret Thatcher werden unzureichend beschrieben: Man kann die öffentliche Unzufriedenheit und die Angst vor radikalen Gruppen nur erahnen – zu oberflächlich werden die Bilder der Skinheads, Rechtsradikalen und Punker gezeichnet. Zwar zielt der Film nicht auf großen politischen Kontext, aber man ist zu bemüht, diese Rahmenbegebenheiten in kurzen fehlplatzierten Aufnahmen zu zeigen, wodurch man dem Gesamtprodukt insgesamt mehr schadet, als dass man hilft. Auch der vermutete Charme bleibt leider aus, was man unter anderen den seltsam getakteten Schnitten zuschieben kann, die keinen klaren Erzählfluss zustande kommen lassen.
Trotz frischen Schauspielerwinds kein Antrieb
Der Hauptverdächtige im Fall des gestohlenen Charmes ist allerdings ganz klar das Drehbuch. Basierend auf einem Jahre zuvor geschriebenen Script, welches in den Credits als „Untitled Joe Strummer Project“ genannt wird, schrieb Matt Brown (Die Poesie des Unendlichen) das finale Buch. Je weiter man dem Film in den Kaninchenbau aus schönen Äußerlichkeiten wie Maske und Kostümbild folgt, desto mehr möchte man den Ton ausschalten. Neben schlagfertiger britischer Slangkommunikation, die zugegeben in der Originalsprache für nette Unterhaltung sorgt, gibt es leider wenig Positives über die flachen, klischeelastigen Dialoge zu sagen.
Durch Jonathan Rhys Meyers glaubwürdige Performance als Clash-Frontmann Joe Strummer kommt ein wenig frischer Wind in die Sache, doch auch hier limitiert das Drehbuch durch ebenso halbgare wie halbherzige Sprüche dessen Einfluss auf die Geschichte. Die Idee, die britische Punkikone als unwahrscheinlichen Berater eines ihm völlig unbekannten Teenagers auftreten zu lassen, hatte als märchenhaftes Extra eigentlich einen schönen Hintergrund. Doch durch den inkonsequenten Plot verliert sich jeglicher rote Faden in einem Wirrwarr aus fragwürdigen Begegnungen und unlogischen Handlungselementen.
Bade oder stirb!
Es sind aber leider nicht nur die groben Drehbuchpatzer und unnötig hektischen Schnitte, die diesen Film beinahe ungenießbar machen. In einer dramatischen Szene, in welcher Shay feststellen muss, dass seine Schwester hohes Fieber hat, ist seine erste Intention ihr ein Bad einzulassen – man kann hier noch auf kindliches Unwissen plädieren, denn das führt logischerweise in keiner Form zu einer Verbesserung der Lage. Shays nächste Idee ist es, sein Geschwisterlein zur Mutter nach London zu bringen, denn sie weiß bestimmt, was zu tun ist.
Die Dramatik erreicht hier ihren Höhepunkt, als die Mutter mit dem Ausruf „Schnell! Hol Wasser für das Bad!“ ihren angetrauten Hippiehaufen aufscheucht und ihrer Tochter somit scheinbar das Leben rettet. Man könnte meinen, sich hier unnötig an einem Detail dieses dramaturgischen Ortswechsels vom Haus der Familie in die Wohnung der Mutter aufzuhalten, allerdings trägt die bade-oder-stirb-Situation einfach nichts zu dieser Szene bei. Man hätte es auch einfacher haben können.
OT: „London Town“
Land: UK, Deutschland, USA
Jahr: 2016
Regie: Derrick Borte
Drehbuch: Matt Brown
Vorlage: Sonya Gildea, Kirsten Sheridan
Musik: Bryan Senti
Kamera: Hubert Taczanowski
Besetzung: Jonathan Rhys Meyers, Daniel Huttlestone, Dougray Scott, Nell Williams, Anya McKenna-Bruce
Bei den Amazon-Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.
(Anzeige)






