(„Mon Oncle“ directed by Jacques Tati, 1958)
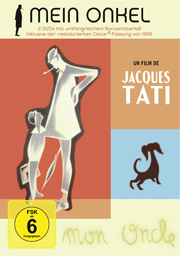 Im Vorspann zu Jacques Tatis Mon Oncle heißt es, man präsentiere dem Zuschauer nun den am häufigsten ausgezeichneten Film aller Zeiten. Diese Behauptung ist heute – wo es mehr Filmpreise auf der Welt gibt, als Graf Zahl durchnummerieren kann – natürlich überholt, und dennoch kann sich Tatis Tragikomödie damit rühmen, einen Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen zu haben. Es gibt dabei viele Gründe, die Tati als Regisseur und Schauspieler zu einer Legende gemacht haben. Zum einen wären da die perfektionistischen Choreographien der Akteure und der eleganten Kamerabewegungen seiner Werke, zum anderen zweifellos auch die Figur des von ihm kreierten Monsieur Hulot, der ähnlich wie Charlie Chaplins Tramp legendär geworden ist, wenn der arbeitsuchende Pariser mit Hut, Pfeife, Regenmantel, zu kurzer Hose und Ringelsocken seine Mitmenschen in den Wahnsinn treibt.
Im Vorspann zu Jacques Tatis Mon Oncle heißt es, man präsentiere dem Zuschauer nun den am häufigsten ausgezeichneten Film aller Zeiten. Diese Behauptung ist heute – wo es mehr Filmpreise auf der Welt gibt, als Graf Zahl durchnummerieren kann – natürlich überholt, und dennoch kann sich Tatis Tragikomödie damit rühmen, einen Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen zu haben. Es gibt dabei viele Gründe, die Tati als Regisseur und Schauspieler zu einer Legende gemacht haben. Zum einen wären da die perfektionistischen Choreographien der Akteure und der eleganten Kamerabewegungen seiner Werke, zum anderen zweifellos auch die Figur des von ihm kreierten Monsieur Hulot, der ähnlich wie Charlie Chaplins Tramp legendär geworden ist, wenn der arbeitsuchende Pariser mit Hut, Pfeife, Regenmantel, zu kurzer Hose und Ringelsocken seine Mitmenschen in den Wahnsinn treibt.
Da wäre auch die moderne Herangehensweise an noch immer aktuelle Themen, worin Mon Oncle keine Ausnahme bildet. Vor Allem ist Tati, und vielleicht zeichnet ihn das als Regisseur am Meisten aus, ein Stummfilmregisseur, der die Erfindung des Tons nicht für unnötige Dialoge nutzt, sondern für einfallsreiche Spiele mit Geräuschen, die im Stummfilm nicht funktionieren würden. So ist auch Mein Onkel ein reiner Stummfilm, bei dem die angebrachten Dialoge lediglich als Verzierungen dienen, aber nicht unbedingt essentiell sind. Dafür spricht auch die Tatsache, dass Monsieur Hulot im ganzen Verlauf kaum ein Wort spricht. Muss er auch nicht.
Hulot führt ein einfaches Leben, aber damit ist er zufrieden. Er lebt in einer kleinen Wohnung in einem ruhigen Viertel von Paris. Einfache Leute leben dort, doch genau dort pulsiert – vielleicht gerade deswegen – das Leben. Die Figuren um Hulot herum werden zu Vertrauten: es gibt einen kleinen Markt mit dem schlechtgelaunten Händler, der seine Kunden beschummelt, das junge Mädchen, das im selben Haus wie der Mann mit dem Regenmantel und der Pfeife wohnt und der er Tomaten schenkt, um dafür einen Bonbon angeboten zu bekommen. Hulot ist lebensfroh, er mag diese Menschen, er mag sein einfaches Leben. Nur seine Verwandten, seine Schwester und sein Schwager, sind mit seiner Lebensweise nicht einverstanden. Die Arpels (Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie) können nämlich für diese einfache Klasse keinerlei Verständnis aufbringen, schließlich arbeitet Charles Arpel in einer erfolgreichen Firma für Schläuche und war daher in der Lage, seiner Familie eine Festung zu bauen, die den Begriff ‚Haus‘ längst nicht mehr verdient. Der futuristische Bau ist überall gesichert, es gibt einen Springbrunnen in Form eines Fisches, einen perfekten Rasen und kleine Kunststeine in allen Farben, während die weiße Küche in all ihrer Sterilität aussieht wie das Zimmer eines Zahnarztes.
Tati nimmt diese Leute, die sich von allem abgeschottet haben und nur unter sich sein wollen, mit beißendem Sarkasmus auf die Schippe, denn er hat begriffen, dass diese Personen den größtmöglichen Eindruck auf andere schinden wollen, sodass sie, bevor sie das Tor für einen Besucher öffnen, zunächst den Springbrunnen anstellen, um ihn, sobald der Gast das Anwesen wieder verlassen hat, wieder ausstellen zu können. Dabei ist auch sofort klar, auf wessen Meinung die Arpels Wert legen, denn ein Gemüsehändler etwa ist es keinesfalls Wert, Wasser im Springbrunnen vergeudet zu werden. All das, was diese Familie tut, geschieht von oben herab – der letzte, der sie dafür verurteilt, ist Monsieur Hulot. Viel eher versucht sich sein Neffe Gerard (Alain Bécourt) vom Lebensstil seiner Eltern zu entfernen, sodass er seine freie Zeit lieber mit seinem Onkel verbringt.
Der größte Fehler, den die Arpels machen ist aber, sich um eine Anstellung Hulots in der Firma Charles‘ zu bemühen, denn als dieser dort einen Job erhält, bringt er das ganze Unternehmen durcheinander, da er mit der Technisierung dort hoffnungslos überfordert ist. Diese Unfähigkeit, sich mit der neuen Technik vertraut zu machen, resultiert in einem fatalen Klimax auf einer Gartenparty seiner Schwester und seines Schwagers, was das Fass zum Überlaufen bringt. Bei Mon Oncle geht es um ein Lebensgefühl, das sich heute noch verdichtet hat und aktueller denn je ist. Neureiche schotten sich immer mehr ab, lassen sich gigantische Villen bauen, um der Außenwelt zu entfliehen, um in ihrer Paranoia vor der Mittel- und Unterschicht zu flüchten. Mit diesen Darstellungen entwirft der Regisseur und Drehbuchautor das Bild einer paranoiden Gesellschaft: da sind die Neureichen, die arroganten Arpels, die viel von sich halten, aber nicht merken, wie sich ihr Sohn immer weiter von ihnen distanziert, sie sind ein Beispiel für eine Gesellschaft, die durch diese Abschattung eine jegliche Selbstständigkeit verloren hat und deutliche weiße Pfeile auf einem Firmenparkplatz braucht, um sich auf dem übersichtlichen Pflaster zurechtfinden oder für die ein alter Rentner Einparkhilfe geben muss.
Es ist eine Paranoia, die aber auch ihre Gründe haben muss und Mon Oncle wäre nicht so scharfsinnig, würde er sich in einseitigem Zynismus ergehen, denn mit einem Augenzwinkern sieht er die Mittelschicht als Auslöser für eben diese panische Angst, welche die Neureichen entwickelt haben. Vor Allem harmlos spielende Kinder werden zu einer fürchterlichen Bedrohung stilisiert, welche die sorgsam organisierte Stille der Erwachsenen in das Wanken zu bringen vermag. Aber auch Monsieur Hulot ist paranoid bzw. wird es durch den zunehmenden Kontakt mit der Technik gemacht, denn im Gegensatz zu seinen Verwandten empfindet er Ehrfurcht, Respekt und fast eine bestimmte Angst vor der eigenständigen Technik, was das Aufeinanderprallen mit der Welt der Arpels unumgänglich macht.
Tatis Mon Oncle ist nicht nur in seiner legendären Szene mit der Gartenparty erstaunlich detailliert, exakt ausgearbeitet, perfekt fotografiert und mit dem richtigen Timing ausgestattet, es ist auch ein äußerst elegantes Porträt einer bedenkenswerten Zeit, in der die Technik längst interessanter und beschäftigungswerter als die Natur geworden ist, denn wen interessiert ein Schmetterling, wenn man einen Staubsauger sein Eigen nennen kann, der das Haus von alleine putzt?
Hinter all dieser vordergründigen Komik und der offensichtlichen Kritik an den abgekühlten Emotionen der abgeschotteten Neureichen, steckt ein viel dramatischerer Aspekt über die menschliche Natur, als man auf den ersten Blick vermuten könnte, denn was Jacques Tati in seiner warmherzigen Schilderung darlegt ist nichts anderes als die Vernachlässigung des eigenen Fleisch und Blutes, der sich lieber von Onkel Hulot, dem rückständigen Junggesellen an die Hand nehmen lässt, um an seiner Seite das wahre Leben zu schmecken, das im sterilen Zuhause mit den Eltern, die panische Angst vor der kleinsten Unordnung haben, längst nicht mehr möglich ist. Denn dadurch ergeht man sich immer weiter in Passivität, so wie Charles Arpel, der andere für sich arbeiten lässt – bis Kot auf ihn herniederregnet, weil der Springbrunnen aus Versehen an eine Kanalisation angeschlossen wurde. Filmkritiker Roger Ebert nannte Tatis Die Ferien des Monsieur Hulot das perfekte Einfangen von Nostalgie von vergangenem Glück. Mon Oncle ist genau das in nicht geringerem Umfang.
(Anzeige)

