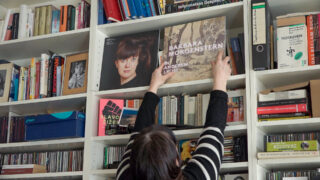Gleich zu Beginn von Barbara Morgenstern und die Liebe zur Sache gibt Regisseurin Sabine Herpich dem Zuschauer einen deutlichen Hinweis darauf, was ihn in den folgenden knapp 110 Minuten erwartet: unkommentierte, ruhige Beobachtung. In der einführenden Szene sitzt die deutsche Musikerin Barbara Morgenstern am Laptop, vertieft in einen entstehenden Song. Nach einer Weile richtet sie das Wort an die Person hinter der Kamera, Herpich also, und teilt mit, sie verspüre den Impuls, das Vorgehen und jeden ihrer Schritte zu erklären. Sie schiebt jedoch sofort hinterher, dass sie das nicht tun werde. Herpich reagiert darauf nicht etwa mit einer Nachfrage oder instruiert ihre Protagonistin, sondern entgegnet schlicht, dass sie das gar nicht müsse. Damit ist der Ton gesetzt: Die Kamera beobachtet, sie drängt sich nicht auf, sie wertet nicht. Die Dokumentation verzichtet auf Off-Kommentare oder erklärende Inserts. Stattdessen entsteht ein intimes, zurückhaltendes Porträt, das sich auf Gesten, Stimmungen und Alltagsmomente konzentriert. Ganz im Vertrauen darauf, dass das Publikum sich auf diese entschleunigte Erzählweise einlassen wird.
Einfach dabei
Direkt im Anschluss wohnen wir einem Zoom-Meeting bei, in dem Barbara Morgenstern mit jemandem über Budget und Fördersummen ihres neuen Albums spricht. Spätestens nun wird deutlich, dass es die Dokumentation ernst meint mit ihrer Beobachterposition: Es gibt keine erklärenden Bauchbinden oder Zwischentitel, (vorerst) keine Interviews, keine Rückblenden. Was wir sehen, ist der der komprimierte Entstehungsprozess eines Albums, von den ersten Ideen über die Studioarbeit bis hin zur Veröffentlichung. Herpich interessiert sich nicht für biografische Hintergründe oder retrospektive Einordnungen, sondern einzig und allein für die Gegenwart der künstlerischen Arbeit, für das konkrete Tun. Dabei bleibt die Kamera stets ruhig und diskret, fast kontemplativ, und gibt Morgenstern (und später auch ihren Kollegen) den Raum, ihre Musik entstehen zu lassen. Auf narrative Eingriffe und dramaturgische Zuspitzung wird bewusst verzichtet.
Die Machart ähnelt stark jener, die schon in Herpichs vorangegangener Dokumentation, Kunst kommt aus dem Schnabel wie er gewachsen ist, zum Tragen kam. Allerdings nahmen die Protagonisten dort einen etwas aktiveren Part ein, interagierten zwar nicht, aber schienen doch zumindest teilweise mit der Kamera zu kokettieren, auf jeden Fall wenn schon nicht in sie, dann doch für sie zu sprechen. Hier ist im Gegensatz dazu alles deutlich passiver. Ob es jetzt so interessant ist, Barbara Morgenstern dabei zu begleiten, wie sie an ihrem Album arbeitet, hängt vielleicht vornehmlich davon ab, ob der Zuschauer Barbara Morgenstern kennt oder zumindest mit der Musikrichtung Elektropop etwas anfangen kann.
Konsequent auf Distanz
Gerade weil Herpich so konsequent auf Distanz bleibt und keinerlei Kontext liefert, verlangt Barbara Morgenstern und die Liebe zur Sache dem Publikum einiges ab. Ohne Vorwissen zu Person oder Werk bleibt vieles unausgesprochen. Diese Reduktion auf das Beobachtbare erzeugt zwar eine stille, fast meditative Nähe, lässt aber zugleich emotionale Tiefe oder Spannung vermissen. Die Dokumentation weist eine gewisse stilistische Konsequenz auf, die aber nicht ohne Risiko daherkommt: Wer sich auf diese Form nicht einlassen kann (oder eben keinen Zugang zu Morgensterns musikalischer Welt findet), der wird hieran vielleicht eher wenig Freude haben.
OT: „Barbara Morgenstern und die Liebe zur Sache“
Land: Deutschland
Jahr: 2024
Regie: Sabine Herpich
Kamera: Sabine Herpich
Mitwirkende: Barbara Morgenstern
Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision, ohne dass für euch Mehrkosten entstehen. Auf diese Weise könnt ihr unsere Seite unterstützen.
(Anzeige)